Hans Pleschinski: Wiesenstein
Schon in Königsallee ist es Hans Pleschinski herrlich gelungen, den großen Thomas Mann in einer besonders absurden biographischen Situation zu erfassen und darin ein nur allzu menschliches Portrait von ihm, ja vom gesamten Mann-Clan zu zeichnen. In seinem neuesten Roman Wiesenstein nimmt er sich den Titan des deutschen Naturalismus vor.
Es ist Februar 1945. Zusammen mit seiner Frau Margarete, dem selbsternannten Privatmasseur Metzkow und der Sekretärin Annie Pollack ist Gerhart Hauptmann auf der Flucht aus dem von den Aliierten in Schutt und Asche gelegten Dresden. Nachdem das Ehepaar dort einige Wochen Kuraufenthalt im Sanatorium verbracht hatte, macht es sich nun per Bahn überstürzt auf den Heimweg ins Riesengebirge. Allen Warnungen zum Trotz – der Flüchtlingsstrom kommt ihnen bereits entgegen und es verkehren nur noch wenige Züge nach Osten – beansprucht der gesundheitlich angeschlagene 82-Jährige, die ihm verbleibenden Tage auf seinem vornehmen Landsitz Wiesenstein im hügeligen Hinterland von Agnetendorf (heute Jagniątków) zu verbringen. 16 Monate wird er dort noch leben. Dann müssen auch die letzten Hausbewohner den Wiesenstein räumen, denn Schlesien ist längst schon in polnisch-russischer Hand.
Vom hereinbrechenden Drama – Plünderung, Mord, Vergewaltigung und Vertreibung der schlesischen Bevölkerung aus dem Hirschberger Tal – wird der Patriarch durch sein treu sorgendes Umfeld gut abgeschirmt: Eine noch immer reichhaltige Küche nebst ausreichend verfügbaren Spirituosen, die aufopfernde Fürsorge von Masseur, Krankenschwester und Gattin und vor allem die schützende Hand dessen, was vom nationalsozialistischen Staatsapparat noch übrig ist, schaffen Raum für die letzten brillant-großbürgerlichen Selbstinszenierungen des Ehepaars. Allem Niedergang zum Trotz werden die alten Rituale stoisch aufrecht erhalten: Die Tischglocke zum Abendessen, die weißen Handschuhe von Hausdiener Pietsch, die tägliche Mittagsruhe mit anschließendem „Produktivspaziergang“ des Hausherrn in der Wandelhalle um die große Amphore herum.
Und dennoch: die Telefonverbindung ist tot, prominente Tischgäste bleiben aus, man tafelt im engsten Kreis von Nachbarn und Personal. Was dem gefeierten Nobelpreisträger – Verfasser der sozialrevolutionären Weber und des Bahnwärter Thiel – in diesen Monaten der Isolation vor allem noch bleibt ist Muße: Muße für das Schreiben, das gleichwohl nicht mehr recht gelingen will, Muße für die Diktatsitzungen zur kritischen Durchsicht alter Werkfassungen, für die Zusammenstellung des zu evakuierenden Nachlasses, aber auch für zwanglose Plaudereien im Rahmen der Interviews, die Schriftsteller Pohl zu einem letzten Gesprächsband zusammenfassen will. Es ist eine Zeit der inneren Einkehr, der persönlichen Bilanzen.
Gerade in diesen vermeintlich abgedichteten Raum dringt nun aber die Zeitgeschichte umso unerbittlicher ein: Das deutsche Kriegsschicksal hat sich gewendet. Der Führer und sein unmittelbares Umfeld haben Selbstmord begangen, Deutschland hat gegenüber den Siegermächten kapituliert und die Illusion vom Großreich unter dem Hakenkreuz, die nicht wenige Deutsche bis ins entlegene Agnetendorf hinein noch genährt hatten, ist endgültig zerbrochen.
Und wie stand nun Gerhart Hauptmann zum Nationalsozialismus? Eine Frage, die den relativ handlungsarmen Roman leitmotivisch durchzieht. Hauptmann zählt zu denjenigen Schriftstellern, die Deutschland auch nach 1939 nie verlassen haben. Doch um welchen Preis? Pleschinski verdichtet diese Frage in biographischen Details, die in der Rückschau erinnert werden. Neben zaghaften Anzeichen inneren Widerstands, z.B. dem Ärger über das nationalsozialistische Propagandaamt, das Hauptmanns Äußerungen entstellt und für eigene Zwecke Missbraucht, erscheinen gleichwohl auch Bilder der Anpassung: Gauleiter Hanke als Tischgast auf dem Wiesenstein. Das Flattern des Hakenkreuzbanners über dem Ferienhaus der Hauptmanns auf Hiddensee. Unbequeme Kompromisse, zumal jetzt, da das Blatt sich wendet.
Kompromittierendes
Bei seinen Recherchen für Wiesenstein hat Hans Pleschinski zum Teil noch unveröffentlichte Materialien aus dem Hauptmann-Archiv gesichtet: Tagebücher und Briefe des Ehepaars, in Vergessenheit geratene Werke und offensichtlich auch Hauptmanns persönliches Exemplar von Mein Kampf…
Die fast achthundert Seiten mit Anmerkungen übersät. Und natürlich war manches ‚P’ am Rand vermerkt, womit der Dramatiker bei Lektüren stets Personen, Namen heraushob, die vielleicht für ein Schauspiel verwendbar wären.
Archivar Behls Nachlese von des Meisters kompromittierender Hitlerlektüre ist ebenso fesselnd wie bestürzend: Die anfänglichen Versuche, sich „in den Braunauer Knaben einzufühlen“. Später dann das Wort „Jüdlein“, kommentarlos unterstrichen. Zu Behls Erleichterung stößt Hauptmanns Identifikationsbereitschaft auf Seite 68 dann aber doch an Grenzen. Als Randbemerkung zum Thema Judenhass findet er lapidar vermerkt: „Das ist nicht gut in Bausch und Bogen“. Ins Feuer mit dem Schund also! Aber darf man „der Nachwelt den Nachweis von Gerhart Hauptmanns Lektüre eines der folgenreichsten Machwerke vorenthalten?“, fragt sich Behl.
Hauptmanns schon früh sich abzeichnende Begeisterung für Deutschtümelei und seine sprachliche Tendenz zum „Grobianischen, besonders altteutsch, kernig und volksnah klingen[den]“, war spätestens mit der Katastrophe des ersten Weltkriegs einer Ernüchterung gewichen, die ihn wieder zurückgeholt hatte in die weniger verfänglichen Tiefen seines unauslotbaren Geistes. Einziges Problem, an dem auch die Behls und Pohls im Roman verzweifeln: ein roter Faden, eine konsequente Entwicklung lässt sich in Hauptmanns Werk nicht ausmachen. Bald erscheint er als Freigeist leidenschaftlich der Zeitgeschichte verbunden, bald entzieht er sich der schnöden Realität in die Welt der Sagen, Mythen und Kasperletheater. Voller Witz, aber auch obszön und nihilistisch tritt er da auf, und vor allem abgehoben genug, um sich den unbequemen Fragen der Gegenwart nicht stellen zu müssen. Anders als Thomas Mann, der ins amerikanische Exil gegangen war und den Nationalsozialismus öffentlich verurteilte, hält sich der große Zauberer aus dem Riesengebirge in seinem Turm verschanzt. „Gespräche mit Merlin“ soll Pohls Interviewband denn einmal heißen.
Pleschinski bindet in seinen Roman viele Zitate aus Hauptmanns Werk ein, vor allem aus den weniger bekannten Schriften, und er spart hier keineswegs mit Ironie. Erschöpft von seiner großen Till Eulenspiegel-Rezitation lässt er den „künstlerischen Masseur“ Metzkow ins Grübeln verfallen:
Wahrlich, schwerster Tobak. Ein Höhepunkt oder das Ende von Dichtung. Sämtlicher Aufwand aller Abenteuer, Verse, Gedanken versickern als Bläschen, Germurmel im: Nichts. Das Inferno soll ehedem mit Geistern, Teufeln, Strafen fasslicher strukturiert gewesen sein als das: Nichts.
[…] Was ritt den betuchten, den bis vor Kurzem kommod lebenden Dichter, Sumpfvisagen die letzte Wahrheit brabbeln zu lassen, dass es die letzte Wahrheit nicht gebe? Als Eulenspiegel galoppierte Hauptmann auf wuchtigen Worten, bei denen der Vortragende Atempausen finden musste, in die kosmischen Weiten und Abgründe davon. Religionen, Gott – Politik sowieso – bedeuteten in diesem Hause nur Treppchen ins Unermessliche. Fürwahr nicht jeder wollte oder konnte sie ersteigen – um sich im Schlamm der Seinsfragen zu wälzen. Hauptmann wusste zu viel. Und nur einiges exakt. So ließ er sich begreifen; und war ganz menschlich.
Der Nihilismus des Till Eulenspiegel ist ein Produkt der traumatischen Erfahrungen des Ersten Weltkriegs und vielleicht ja schon ein existenzphilosophischer Auftakt ins 20. Jahrhundert, denn fast zeitgleich beginnt noch ein ganz anderer Meister aus Deutschland, sich im „Schlamm der Seinsfragen“ zu wälzen: Martin Heideggers Ontologie-Vorlesung von 1923 weist schon voraus auf Sein und Zeit. 1933 dann die einschneidende Rektoratsrede an der Universität Freiburg. In seinem Ehrgeiz, den Nationalsozialismus seiner eigenen Philosophie einzuverleiben und die Bewegung dadurch mitzugestalten, hat Heidegger der Nachwelt bekanntlich ein besonders abschreckendes Beispiel für die Verführbarkeit des Intellekts hinterlassen. Dass er von Hitlers Politik dann doch enttäuscht wurde, ändert nichts an der Tatsache, dass sein tief sitzender Antisemitismus – wie die 2014 veröffentlichten Schwarzen Hefte inzwischen belegen – als integraler Bestandteil seines Denkens gesehen werden kann.
Die drolligen Schrullen des Greises
Pleschinski verortet Hauptmann ganz anders. Weder als Fürsprecher noch als Kritiker wird er konsequent greifbar. Selbst wenn er die nationalsozialistische Ideologie nicht teilte, scheint er seinen Status als Nobelpreisträger und die damit verbundenen gesellschaftlichen Privilegien doch allzu lieb gewonnen zu haben, um sie in der offenen Stellungnahme gegen die Barbarei aufs Spiel zu setzen. In diesem Dilemma wird ihm sein großbürgerlicher Olymp nun selbst zur Falle. Inmitten des Niedergangs steht er jetzt mit dem Rücken zur Wand, zu sehr, um sich der bitteren Selbsterkenntnis noch entziehen zu können.
Pleschinski inszeniert das einfühlsam und ohne moralischen Zeigefinger. Es geht ihm um den Menschen Gerhart Hauptmann, um die drolligen Schrullen des Greises, der gerne mal stotternd, aber immer noch klaren Verstandes im intellektuellen Luxus seiner literarischen Fragmente badet, zu neuen Welterklärungen ausholt, dann wieder zweifelt, sich im Unverbindlichen verliert („egal“). Voll witziger Ironie holt er den Titan der deutschen Literatur und mit ihm auch dessen Hofstaat herunter in die Sphäre der Sterblichen. Bei aller Schwere des Themas hat Hans Pleschinski hier wieder ein intelligentes Buch geschrieben, das sich zugleich höchst amüsant liest.
Auf dem Wiesenstein bleibt es jedenfalls bis zum Schluss spannend. Denn wie flexibel auslegbar und anschlussfähig Gerhart Hauptmanns Werk ist, wird spätestens dann klar, wenn Genosse Johannes R. Becher, Präsident des Kulturbunds des neuen Deutschland dort aufkreuzt, um Hauptmann enthusiastisch für die sozialistische Kunst zu gewinnen: „Und Ihr Aufschrei, Genosse, gegen das Kapital, Kapitalisten und ihre Helfershelfer […] Jetzt fehlt nur noch Ihr Lobpreis Stalins!“.
Da kann man wohl nur noch abermals mit Pohl seufzen (und vielleicht ja auch mit Pleschinski):
Es würde eine Crux werden, die Notate zu einem schlüssigen Ganzen zu fügen. Doch es konnte nicht seine Aufgabe sein, die Weisheiten Merlins zu einem wetterfesten Denkgebäude zusammenzunieten. So war es eben: Wahrheiten schwammen wie Goldfische in einem großen trüben Teich. Wohl dem, der die für sich tauglichen herausfischte.
Hans Pleschinski: Wiesenstein
C.H. Beck 2018 / 552 Seiten / ISBN: 978-3406700613

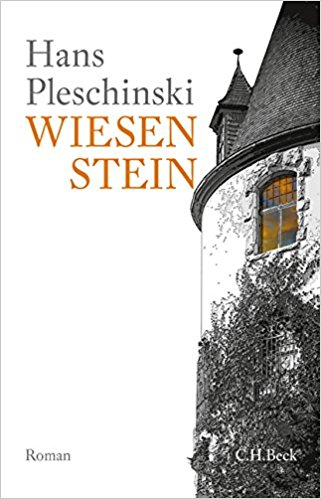
Schreibe einen Kommentar