Josef Bierbichler: Mittelreich (2011)
„‘Wenn ein Buch wirklich gut ist, dann erreicht es jeden, überall auf der Welt‘, erklärt mir eine der Leiterinnen des Edinburgh Book Festival. ‚Es ist interessant‘, sage ich zu ihr, ‚dass dieser Glaube an den universellen Reiz guter Literatur so wunderbar mit den Bedürfnissen der Wirtschaft harmoniert. Je besser ein Buch ist, je mehr es über seinen lokalen Kontext hinausgeht, desto mehr Leute werden es weltweit kaufen.‘ Der universalistische Ansatz verlangt, dass wir ein leicht kommunizierbares, allgemeines Element herauspicken oder entdecken – ungleiche Machtverhältnisse, existenzielle Ängste oder einen Schlüsselgedanken, der alle Menschen betrifft –, und sagt uns, dass dieses Element das Wesentliche an einem Kunstwerk ist, und nicht die Art und Weise, wie das Werk sich mit seiner Ursprungskultur beschäftigt. Aber was ist, wenn die Qualität einiger guter Kunstwerke gerade in ihrer Beziehung zum Lokalen und Zeitgenössischen liegt, zu dem Leben, das ihnen mitgegeben wurde, um hier und jetzt erfahren zu werden?“
Dieses Zitat, das aus dem hier schon einmal erwähnten Buch von Tim Parks stammt,1 wirft interessante Fragen zum Thema Literatur in Zeiten der Globalisierung auf. Sofern man heute überhaupt noch von Nationalliteraturen sprechen kann, ließe sich zum Beispiel die Frage stellen, wieviel Japan eigentlich noch in den Büchern von Haruki Murakami steckt oder wieviel Türkei in denen von Orhan Pamuk. Oder wie verdaulich für westliche Leser eine Literatur wäre, die ihr arabisches Erbe großzügig integriert. Sind diese Literaturen in der Form, in der sie bei uns ankommen, nicht längst schon ein eingedampftes kulturelles Desiderat, das als bekömmliches Süppchen auf dem weltweiten Buchmarkt ausgeschenkt wird? Wie viele Schriftsteller schielen heute beim Schreiben mit einem Auge nach diesem Weltmarkt? Und verdankt die amerikanische Literatur ihren internationalen Erfolg nicht ihrer relativen Traditionslosigkeit?
In Zeiten der Globalisierung mag es reaktionär wirken, von Schriftstellern zu erwarten, dass sie der literarischen Tradition, der Kultur und dem lebensweltlichen Kontext ihrer Herkunftsregion verbunden bleiben. Interessant ist solche Literatur aber allemal, wenn auch vielleicht nicht immer problemlos zugänglich. Die These wäre also: Je höher der Anteil an kulturellen Eigenheiten in einem Buch, desto schwerer wird es international rezipierbar, umso reichhaltiger aber auch die Lektüreerfahrung für diejenigen, die mit diesem Umfeld vertraut sind. Mit welchen Strategien gelingt es Schriftstellern demnach, das Allgemeine und das Besondere zu verbinden – mit ihrer Literatur Verbreitung zu finden und dennoch den eigenen Wurzeln nah zu bleiben?
Kürzlich las ich Josef Bierbichlers 2011 erschienenen Roman „Mittelreich“. Bierbichler ist ein bekannter bayerischer Theater- und Filmschauspieler und ein lokales Urgestein. Sein Buch, das er unlängst selbst verfilmt hat,2 ist ein modernes bayerisches Epos. Über drei Generationen und zwei Weltkriege, das anschließende Wirtschaftswunder und die 68er-Generation erzählt er bis in die 80er Jahre hinein die Geschichte einer zu materiellem Wohlstand aufsteigenden Wirtsfamilie im fiktiven Seedorf am Starnberger See und schöpft dabei umfangreich aus der eigenen Biografie. Es geht um Tradition, Generationenkonflikte, die Last des Erbes und immer auch um die Auseinandersetzung mit Fortschritt und Fremdem. Der Frage nach dem oben genannten Spannungsverhältnis bin ich in diesem Buch einmal nachgegangen.
Urige Wörter
Ein Problem des Dialekts ist es, dass er zwar in hohem Maß identitätsstiftend wirkt, doch wie bringt man ihn glaubwürdig in Literatur ein, und zwar so, dass sie noch lesbar bleibt? Es muss eine Literatursprache geschaffen werden, die erdig genug ist, um das Lokalkolorit zu wahren und die dieses Fremde zugleich einer größeren Sprachgemeinschaft zugänglich macht. Bierbichler ist hier nicht allzu experimentierfreudig und bewegt sich vor allem im Bereich des Lexikalischen: „Zeitlang“ hat die alte Mare nach ihrem toten Hund; das „Gschwerl“ ist der familiäre Anhang des versoffenen Stammtischbruders; bloß „hereingeschmeckt“ haben die „geldigen“ Villenbesitzer die sich neuerdings gegenüber den Dörflern aufspielen; „depperte Schwammerl“ muss der Pankraz gegessen haben, als er voller Enttäuschung über den aufmüpfigen Nachwuchs sein Erbe der Kirche vermachen will; und „Katzlmacher“ schimpft man abschätzig die italienischen Gastarbeiter, die ab Mitte der 50er Jahre ins Land geholt werden und unter den jungen Weibern Verwirrung stiften. So weit nur einige Beispiele.
Ein kurioser Neologismus sorgt außerdem für Wiedererkennungseffekte bei einheimischen Lesern: 2001 hatte Fürstin Gloria von Thurn und Taxis die Boulevardpresse mit einer Wortneuschöpfung in Wallung gebracht. Sie sprach davon, dass AIDS in Afrika so verbreitet sei, weil die Schwarzen gerne „schnackseln“. Der Begriff sorgte peinlicher Weise für ein so starkes Medienecho, dass er 2004 als „süddeutsch, österreichisch umgangssprachlich“ in den Duden aufgenommen wurde. Was dieser Begriff latent mittransportiert, nämlich die diskriminierende Konnotation seines Entstehungskontextes, ist im Duden natürlich nicht erfasst. Für jeden, der damit vertraut ist, schwingt sie aber ironisch mit, wenn Bierbichler im Roman jetzt die dörflichen Ausläufer der verhassten 68er „schnackseln“ lässt. Die suchen nämlich zunehmend die ländlichen Seeufer heim und bringen dabei die bäuerlich-katholische Wertewelt ins Wanken. Wer um diesen Zusammenhang nicht weiß, liest darüber hinweg. In einer Übersetzung wird dieser Kontext gänzlich verloren gehen.
Sprechende Namen
Über das Potential von Namen, imaginär eine ganze Kindheit wieder auferstehen zu lassen, wissen wir spätestens seit Prousts Recherche. Dieses Prinzip funktioniert nicht nur in Frankreich. Welcher einheimische Leser hat nicht sein ganz persönliches déjà-vu, z.B. mit der alten katholischen „Mare“, die bei der Fernsehübertragung der Papstwahl (ihr Erstkontakt mit dem neuen Medium) direkt in den Himmel auffährt? Außerdem beziehen zwei der zentralen Figuren ihre Namen aus den Tiefen der christlichen und der griechisch-römischen Geschichte: Vom prosperierenden Seewirt Pankraz führt eine Linie über den katholischen Eisheiligen etymologisch zurück zum griechischen „Allherrscher“. Und des Pankraz zänkische Schwester Philomena dürfte ihre Jungfräulichkeit mit ähnlich großem Eifer verteidigt haben, wie ihre Namenspatronin, die christliche Märtyrerin aus dem dritten Jahrhundert. Wegen ihrer Tätigkeit bei der Reichspost verpasst ihr die Allgemeinheit dann immerhin noch den weniger dramatischen Namen „Brieftaube“.
Dass Personen über Spitznamen charakterisiert werden und dass dabei Metaphern aus dem Tierreich besonders eindringlich sind, ist bekannt. Auch literarisch können sie einen identitätsstiftenden Beziehungsreichtum entfalten. Eine der Romanfiguren ist fast unmerklich im Boden der germanischen Mythologie und Fabel verwurzelt: Vom Zuber Storch, dem Dorfmetzger, weiß man: Sein „Körper war rund, und sein Fleisch wog schwer, aber seine Beine waren so dünn wie die von Adebar, dem Sumpfgänger.“ Auda bera (ger.), der Storch als Glücksbringer und Lebensspender! Und doch trügt der Schein, denn diese alte Symbolik wird von der brutalen Lust unterlaufen, mit der der Zuber dann beim Schlachten das Schwein vom Seewirt totschlägt. Die rundliche Körperfülle wird zur ekelerregenden Fleischlichkeit. Fast überall in diesem Roman.
Zeitlose Abgründe
Gerade aus dem Abstoßenden heraus entwickelt Bierbichler eine an vielen Stellen ins Poetische umschlagende Kunstsprache von archaischer Monumentalität. Manchmal sind es traumatische Visionen, z.B das nächtliche Erscheinen dreier entflohener KZ-Häftlinge auf dem Lothof, das Gemetzel beim Schlachten eines Schweins oder der Missbrauch des Seewirt-Sohns durch einen Päderastenpater im Kloster Heilig Blut; oder aber menschliche Borniertheiten, z.B. die auf dem Land verbreitete Einstellung zur Homosexualität, zu den italienischen Gastarbeitern oder die lange – bis in die Faschingslustbarkeiten der 50er Jahre hinein noch schwelende NS-Vergangenheit:
Auf einem abgeräumten Tisch, mit unbewegter Mimik, tanzt die Hitlerfrau mit aufgeschlitztem Hosenbein den spanischen Flamenco. Dicht steht die Meute ungebundner Männer um den Tisch herum und klatscht im Rhythmus der Musik den Urtrieb wahllosen Begehrens an die Luft. Andere schauen aus Augenwinkeln nah an Gattinnen vorbei, aus der selbstgewählten Ehegruft heraus, hinauf zur selbsternannten Göttin. Mit erregenden Gebärden hat die Göttin im Gewand des alten Gottes ihre braun gesprenkelte Krawatte von ihrem marmorweißen Hals geknotet und dabei mit obsessivem Schwung gleich noch die oberen drei Knöpfe mit herausgerissen. Mit nasser Zungenspitze netzt sie ihre roten Lippen, mit ölgetränkten Blicken schaut sie, aus schwarz ummalten Augen, aus der geilen Höhe hinunter in das gierige Verlangen unter ihr. Das ist ja … unerhört!, schimpft die Philomena, des Seewirts sittenstrenge Schwester, die in der Tür zum Saal, wie jedes Jahr um diese Zeit, ihren angestammten Posten für Geschlechtertrennung und Moral bezogen hat. Diese schamlose Person! Wer ist das überhaupt? – Das ist doch die Frau Meinrad, die Cousine des Herrn Bonvivant… (157 f.)
Es ist der närrische Tanz ums goldene Kalb, den Bierbichler hier in pointierter Zuspitzung auf die Abgründe der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts inszeniert. Trotz ihrer konkreten historischen Verortung erscheint diese Passage zeitlos, weil sie das Unerhörte bändigend einfängt in Rhythmus und Klang und darin der kernigen Fülle des klassischen Epos oder der Metamorphosen Ovids nahekommt.
Mittelreich ist ein Buch, das mit dem durchstilisierten Charme eines Holzhackers daherkommt. Jenseits aller Heimattümelei lässt es das Unvergängliche am Rustikalen, Bornierten, Kreatürlichen sichtbar werden. Diese nur scheinbar untergehende Welt wird im Lauf der Erzählung in eigentümlichen Kontrast zur allmählich um sich greifenden, sauberen, kapitalistischen Anzugmentalität treten; denn die steht längst schon parat, sie würdig abzulösen.
Zu Hause bleiben?
In Mittelreich geht es um eine Heimat, die gar nicht bei sich bleiben kann, weil das Fremde immer schon von allen Seiten hereindrängt, aufgezwungen durch Kriege, Flucht und Vertreibung. Ständig kommt es zu Begegnungen – der französischen Zwangsarbeiter mit den bayerischen Kühen, der bigott-rassistischen Philomena mit dem schwarzen Gesicht eines amerikanischen Soldaten (oder der schwarzen Schwester Oberin vom Kloster Poing) und aller Dörfler mit den eigenen flüchtigen Landsleuten: da ist der Schlesier Viktor Hanusch, der zum unentbehrlichen Mitglied der Seewirt-Familie wird und bis an sein Lebensende in Seedorf bleibt, oder das ostpreußische Fräulein von Zwittau, das die heile bayerische Geschlechterwelt auf den Kopf stellt, auch wenn sie das am Ende selbst ihren Kopf kostet.
Doch die ‚Entfremdung‘ ist auch hausgemacht. Das voralpenländlich-idyllische Seedorf ist ein Prototyp der aufkommenden Tourismusbranche. Schon vor dem ersten Weltkrieg vermietet der Seewirt allsommerlich seine Zimmer an Städter, die meist „so gebildet“ daherreden, dass der Pankraz dann im Kriegslazarett aus dem damals Aufgeschnappten genug Rhetorik zusammenkratzen wird können, um sein zerschossenes Bein zu retten. Dass das Fremde – trotz kleinkarierten Befremdens – immer auch Bereicherung war, daran lässt Bierbichler keinen Zweifel. Es dürfte kein Zufall sein, dass das Buch überraschend in der schlesischen Mundart von Viktor Hanusch einsetzt. Der Umstand, dass es dann auch in dessen „sentimentalen“ und fremdenfeindlichen „Geseire von früher“ verhallt, während der Sohn vom Seewirt ihm beim Sterben zuschaut, gibt keinen Anlass zum Optimismus.
Die stilistisch anspruchsvolle Inszenierung des Banalen ist eine Herausforderung, die in Mittelreich auch ihren Preis hat, z.B in Form von teils holprig wirkenden Register- und Stilwechseln oder einer Ironie, die bis an die Schmerzgrenze getrieben wird und die Handlung stellenweise ins Surreale kippen lässt. Es überrascht nicht, dass dieses Buch trotz inhaltlicher Relevanz und hoher sprachlicher Qualitäten vor allem ein nationaler Erfolg geblieben ist, der sich immerhin bis nach Neuruppin herumsprechen konnte: 2016 wurde dem Autor der Fontane-Literaturpreis verliehen.
Ein universales Heimatbuch ohne internationale Erfolgsgewähr also. Und das ist auch gut so.
Josef Bierbichler: Mittelreich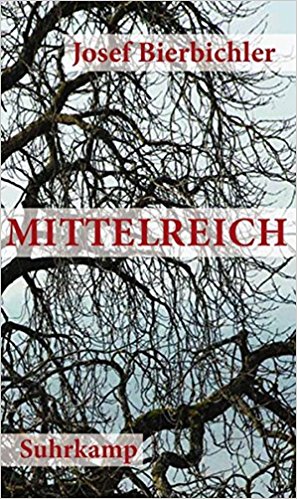
Suhrkamp / 391 Seiten / ISBN 978-3518422687

Schreibe einen Kommentar