August Strindberg: Das rote Zimmer (1879)
Nämdö ist eine mittelgroße Insel am westlichen Rand der schwedischen Schärengärten, etwa 50 km von Stockholm entfernt. Mit dem Postschiff der Waxholmsbolaget dauert die Anreise vom Festland aus etwa zwei Stunden. Dafür wird der Reisende dann auch belohnt, denn er findet dort alles was er sucht: Üppige Natur, ein paar einsam verstreute, rot getünchte Holzhäuschen, ein staatliches Spirituosengeschäft („Systembolaget“) und seine Ruhe.
Als wir im Sommer dort waren, hatte ich freilich nicht damit gerechnet, dass dieses gottverlassene Fleckchen Erde längst schon literarisch verewigt ist, und zwar in einem schwedischen Klassiker, den ich mir als Reiselektüre eingepackt hatte: August Strindbergs Röda Rummet (Das rote Zimmer, 1879). In einem der letzten Kapitel dieses Romans wird das unscheinbare Nämdö zur Projektionsfläche für Strindbergs frühe Kritik an einem industriellen Spekulantentum, das noch nicht einmal vor der unschuldigsten aller Sommerfrischen zurückschreckt.
Am 18. Juni berichtet der angehende Pathologe Borg in einem Brief:
Vor dem Häuschen, in dem wir wohnten, stand ein schönes Eichengehölz, das angenehm Schatten spendete und gleichzeitig die Meereswinde abhielt. Im allgemeinen verstehe ich mich nicht auf Bäume und Natur, aber ich liebe, wenn es heiß ist, den Schatten. Eines Morgens, als ich das Rouleau hochzog, kannte ich mich nicht mehr aus: die Bucht lag offen vor mir, und eine Kabellänge vom Strand war eine Yacht verankert. Die Eichen lagen gefällt da, und Isaac saß auf einem Baumstumpf, las Euklid und zählte die Baumstämme, die auf die Yacht gebracht wurden. Ich weckte Falk. Er war verzweifelt und wütend und geriet mit Isaac in einen Wortwechsel. Der hatte bei dem Geschäft tausend Kronen in die Tasche gesteckt. Der Fischer bekam zweihundert – mehr hatte er nicht verlangt. Ich war böse; nicht wegen der Bäume, sondern weil ich nicht selbst auf diese Idee gekommen war.
Das rote Zimmer gehört zu den naturalistischen Werken, die einen Auftakt der europäischen Literatur der Moderne bilden. Es verbindet beißende Gesellschaftssatire mit einer frühen, aber nicht minder treffsicheren Diagnose des aufkommenden Kapitalismus. Gefördert durch bahnbrechende Entwicklungen in Wissenschaft und Technik greift in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts europaweit die Industrialisierung um sich. Schwedens Wälder und Erzminen sichern den Reichtum des Landes. Die im Entstehen begriffene Massenkultur braucht Papier für Zeitungen und Bücher, doch während Schienen und Eisenbahnnetze ausgebaut werden und das Ausland Kanonen bestellt, verarmen Schwedens Bauern und sind gezwungen, nach Amerika auszuwandern oder in die Elendsviertel der Großstadt zu ziehen. In schöner Synchronie mit dem Fortschritt treten nun in Strindbergs Roman die übelsten aller menschlichen Eigenschaften zu Tage. Sämtliche Lebensbereiche – Politik, Presse, Religion, Kunst und nicht zuletzt auch die Wissenschaften selbst – werden aufgesogen von den Gesetzen des Marktes. Nichts ist mehr sicher vor menschlicher Scheinheiligkeit und Gier. Das klingt übel, doch gerade der hohe Wiedererkennungseffekt, der sich beim Lesen einstellt, macht dieses Buch zu einem Klassiker:
In jener Zeit, die jetzt die gute genannt wird, obwohl sie für viele sehr böse war, hatte man eben die größte Entdeckung des Jahrhunderts gemacht: dass es billiger und angenehmer ist, vom Gelde anderer zu leben als von eigener Arbeit.
Allzu viel scheint sich nicht geändert zu haben, wenn man Strindbergs satirisches Portrait der aufkommenden Stockholmer Versicherungsbranche liest: Da schürt die neu zu gründende Seeversicherungsaktiengesellschaft Triton in ihrer Werbekampagne mit einer abenteuerlich rührseligen Geschichte ungeniert Ängste beim potenziellen Kunden: Ein wohlhabendes Ehepaar sei vor Skåg samt Hausrat im Meer versunken, nachdem es doch glatt versäumt habe, tags zuvor die letzte noch ausstehende Versicherungsprämie zu zahlen! Da haben wir es: „Weinend“ fielen die inzwischen mittellosen Kinder „einander in die Arme und schwuren, in Zukunft ihre Sachen immer zu versichern und niemals zu versäumen, ihre Lebensversicherungsprämie zu bezahlen“.
Unglücklicher Produzent dieses Werbepamphlets wäre beinahe der junge Protagonist des Romans selbst geworden, Arvid Falk, der schon im ersten Kapitel seine gesellschaftlich vielversprechende (wenn auch sinnfreie) Beamtenkarriere gegen die windige Existenz eines Schriftstellers eintauschen will. Zwar ist ihm bewusst, dass man sich als solcher erst einen Namen machen muss – und sei es mit kleinen Auftragsarbeiten. Mit der Triton-Episode erlebt er jedoch eine besonders ernüchternde Einführung in die Realität des zeitgenössischen Verlagswesens. Für seine Verse interessiert sich dort nämlich keiner.
Es sind Philosophen, Maler, Schriftsteller, Schauspieler oder solche, die es werden wollen, die der Vereinnahmung durch das Kapital den erbittertsten Widerstand entgegensetzen. Deshalb werden sie in der Literatur der Moderne auch gerne als Protagonisten bemüht, denn sie taugen ganz besonders zum Seismographen für die moralische Dekadenz ihres Umfelds. Bei Strindberg ist es ein kleiner Kreis von Bohemiens, der sich regelmäßig im „roten Zimmer“ von Berns Stockholmer Salon trifft, vor allem, um sich materiell gegenseitig über Wasser zu halten: Gemeinsam wird hier gezecht, gebürgt, gelitten und gelästert. Welcher der dort verkehrenden verkrachten Existenzen nun wirklich Talent hat, ist schwer zu sagen, denn über künstlerischen Erfolg oder Misserfolg entscheidet allein die Presse und die arbeitet freilich nach eigenen Grundsätzen:
– Vielleicht lest ihr die Bücher, die ihr rezensiert, gar nicht?
– Wer, glaubst, du, hat Zeit, Bücher zu lesen? Genügt es nicht, wenn man über sie schreibt? Man liest Zeitungen, und das reicht gerade. Übrigens haben wir das Prinzip, alles zu verreißen.
Selbstverständlich hat man in der Redaktion der Zeitungsaktiengesellschaft Grauer Mantel für dieses Prinzip auch eine psychologische Begründung parat.
Strindberg erzählt in Das rote Zimmer keine Geschichte mehr, stattdessen schimmert in diesem Erstlingsroman schon seine brillante dramatische Begabung durch und eine strukturelle Verwandtschaft mit dem, was er zehn Jahre später zum Stationendrama ausbauen wird (Nach Damaskus, 1898). Den Spannungsbogen des klassisch-aristotelischen Fünfakters wird er dann auflösen in eine Reihe von isolierten, gleichrangig nebeneinanderstehenden Episoden. Diesen formalen Ansatz nimmt Strindberg im Roten Zimmer schon vorweg: Der Roman beginnt mit dem enttäuschten Rückzug Arvid Falks aus seiner Tätigkeit als Assessor des Kollegiums für die Auszahlung von Beamtengehältern und seinem Wunsch, ein aufrichtiges Leben als Literat zu führen und er endet mit seiner „Genesung“: der erfolgreichen Wiedereingliederung in die bürgerliche Gesellschaft. Dazwischen reihen sich in 27 Kapiteln Begegnungen mit den verschiedensten Instanzen des öffentlichen Lebens – dem Verleger, der Presse, dem Parlament, der Kirche, dem Theater etc. –, an denen der kleine Künstlerkreis sich meist vergeblich abarbeitet. Der Perspektive eines Kameraauges gleich entwirft Strindberg hier also eine moderne Form für die satirische Spiegelung unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen und wird damit entscheidenden Einfluss auf die expressionistische Literatur der Moderne nehmen.
Strindbergs Erstlingswerk liest sich über weite Strecken erfrischend leicht. Es sprüht vor Witz und einer satirischen Virtuosität, die oft komisch wirkt. In korrupten Verstrickungen werden Betrüger zu Betrogenen, ohne dass diese ruinöse Dynamik je zur Ruhe käme. So ist auch der gute Stern der Seeversicherung Triton nicht von Dauer und bietet Anlass für neue Skandale: Arvid Falks geschäftstüchtiger älterer Bruder wird seine christliche Nächstenliebe unter Beweis stellen, indem er der Kinderkrippe Betlehem (einer Wohltätigkeitsinitiative seiner Frau) die im freien Fall befindlichen Triton-Aktien überlässt. Ihm selbst bringt das schnell noch den Vasaorden für Wohltätigkeit ein, die Krippe dagegen wird stranden, zusammen mit seiner Frau und dem Versicherungswrack.
Bei aller satirischen Überzeichnung liegt gerade in dieser abgründigen Skrupellosigkeit auch etwas Beunruhigendes, denn der Roman bietet keinerlei Geländer. Alternativen zur universellen Heuchelei werden nirgends greifbar. Dass christliche Priester Männer sind, die „die Erlösung fashionable gemacht“ haben, um daraus ordentlich Profit zu schlagen, ist nichts Neues. Doch selbst zaghaft aufkeimende politische Initiativen laufen ins Leere und der linke „Arbeiterverein Nordstern“ erweist sich als Marionette der Mächtigen.
Bleibt am Ende also nur die Frage nach den Perspektiven des Künstlertums selbst. Doch auch hier kommt man nicht weiter, denn der Roman beschränkt die Entwicklungsmöglichkeiten auf zwei Optionen: Anpassung oder Tod. Es ist das Spannende und wirklich Tiefsinnige an diesem Buch, dass Strindbergs existenzielle Kritik gerade auch diejenigen Figuren erfasst, die er als Medium einer radikalen Infragestellung der Gesellschaft einsetzt, nämlich die Künstler selbst.
Die meisten von ihnen werden sich anpassen: Der Maler Lundell gibt seine wenig lukrativen religiösen Sujets auf und wird statt dessen Portraitist „geschäftsführender Direktoren, die ihn zum Lehrer an der Kunstakademie“ machen. Der junge Schauspieler Rehnhjelm wird „Verwalter auf einem großen Gut“ und ist mit seiner Existenz einigermaßen zufrieden. Arvid Falk kehrt wieder in den Schoß des Beamtentums zurück und tritt eine Stelle als Lehrer für Schwedisch und Geschichte in einem vornehmen Stockholmer Mädchenpensionat an. Selbst die Karriere der scheinbar erfolgreichsten Figur unter den Bohemiens bleibt mehr als fragwürdig: Der Maler Sellén findet Aufnahme in die renommierte Pariser Académie royale de peinture et de sculpture, diejenige reaktionäre Institution also, in der man sich in Frankreich gerade über die ersten Impressionisten totlacht.
Die liebenswürdigste und zugleich tiefgründigste Figur hingegen, der weise Narr des Romans, setzt seinem Leben selbst ein Ende. Olle Montanus „glich einem zivilisierten Bauern […] einem Hafenvagabunden, einem Handwerker oder einem Künstler – seltsam verkommen wirkte er.“ Wir begegnen ihm erstmals in einer Vorstadt-Künstlerkolonie bei seiner Lieblingsbeschäftigung, dem Philosophieren. Um etwas Geld zu verdienen, steht er dem Maler Lundell als Schächer für eine Kreuzabnahme Modell. Später wird er irrtümlich verhaftet, weil man ihn mit Gegenständen, die er ins Pfandhaus bringen will, erwischt und für einen Dieb hält. Wieder auf freiem Fuß nimmt er eine Hilfsarbeit bei einem Steinmetz an, so dass sich seine finanzielle Lage etwas bessert. Der Roman verliert ihn dann längere Zeit aus dem Blick. Nachdem er sich ertränkt hat, finden seine Freunde bei ihm einen schriftlichen Nachlass, gewidmet dem „der es lesen will“. Diese Passagen bestehen, wie Renate Bleibtreu gezeigt hat, teilweise aus Fragmenten, die der Autor schon früh in seinen persönlichen „Notizen eines Zweiflers“ formuliert hat und die er nun zum Teil wörtlich Olle Montanus in den Mund legt. Sie dokumentieren Strindbergs eigene quälende Auseinandersetzung mit dem Künstlertum, mit Problemen der sozialen Gerechtigkeit und der Frage nach Religion und Glauben. Zitiert sei hier abschließend Olles profunde Diagnose des „Künstlertriebs“:
Den vielbesprochenen Künstlertrieb kann ich analysieren, da ich ihm selbst ausgesetzt war. Er beruht zunächst auf der breiten Basis des Durstes nach Freiheit – nach Befreiung von nützlicher Arbeit. Deshalb hat auch ein deutscher Philosoph das Schöne als das Unnütze definiert; denn wenn ein Kunstwerk nützlich sein will, eine Absicht oder eine Tendenz verrät, so ist es häßlich. Außerdem beruht der Künstlertrieb auf Hochmut: der Mensch will in der Kunst Gott spielen; nicht als ob er etwas Neues schaffen könnte (das kann er nicht!) sondern er will verändern, verbessern, ordnen. Er beginnt nicht damit, die Vorbilder, das heißt die Natur zu bewundern, sondern er kritisiert sie. Alles findet er mangelhaft und will es besser machen. Dieser Hochmut, der ihn treibt und diese Befreiung vom Fluch des Sündenfalls, der Arbeit, bewirken, dass der Künstler über den andern Menschen zu stehen vermeint, was er in gewisser Weise auch tut, aber er will es ständig bestätigt haben, da er sich anderenfalls zu leicht selber erkennt – nämlich erkennt, wie nichtig sein Tun ist und wie unberechtigt seine Flucht vor dem Nützlichen. Dieses ständige Bedürfnis nach Anerkennung seiner unnützen Arbeit macht den Künstler eitel, unruhig und oft tief unglücklich; gewinnt er aber Klarheit, so versiegt häufig seine Schaffenskraft, und er geht unter, denn ins Joch zurückkehren, wenn er einmal die Freiheit gekostet hat, das kann nur der Religiöse.
Das rote Zimmer machte August Strindberg 1879 in Schweden über Nacht berühmt. Mit den zwei Folgeschriften, dem Geschichtswerk Das schwedische Volk, das die glorreichen Könige dezent übergeht, sowie der Gesellschaftssatire Das neue Reich legte Strindberg noch einmal nach. Dies trug ihm jedoch sehr bald schon das Unverständnis, wenn nicht gar die Feindschaft breiter gesellschaftlicher Kreise ein. Es folgten „eigentümliche Antworten“ seiner literarischen Gegner, von kleinen privaten Schikanen gegen ihn und seine Familie bis hin zur journalistischen Branntmarkung als „von allen guten Geistern verlassener Sonderling“ (Bleibtreu). 1883 verlässt er mit seiner ersten Frau Siri und den beiden Töchtern Schweden und begibt sich in ein 15-jähriges freiwilliges Exil, das ihn in verschiedene europäische Länder führen wird.
In ihrem kundigen Nachwort zu den Notizen eines Zweiflers weist Renate Bleibtreu darauf hin, wie zögerlich in der Rezeption die immer noch gängige Vermutung bestritten wird, Strindberg wäre zeitweise wahnsinnig gewesen: „Selbst in Schweden bewegt sich nur langsam Strindbergs schon zu Lebzeiten erstarrtes Bild“.
August Strindberg: Das rote Zimmer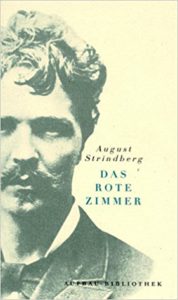
Ich zitiere nach:
Deutsch von Hilde Rubinstein / Aufbau Verlag 1998 / 328 Seiten / ISBN: 978-3746660325 (antiquarisch)
Inzwischen ist eine sehr gelobte Neuübersetzung verfügbar:
Deutsch von Renate Bleibtreu / Manesse 2012 / 576 Seiten / ISBN: 978-3717522386
Zur Vertiefung:
August Strindberg: Notizen eines Zweiflers. Schriften aus dem Nachlass
Herausgegeben und übersetzt von Renate Bleibtreu / Berenberg 2012 / 320 Seiten / ISBN: 978-3937834467

Schreibe einen Kommentar